Luftwiderstand im Tunnel
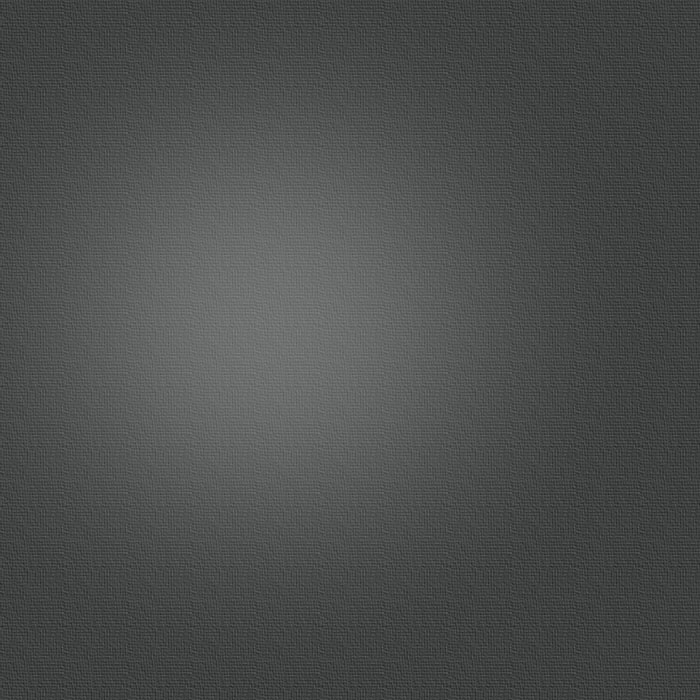
Mittwoch, 03. November 2010
Um den Tunnelknall zu vermeiden gibt es verschiedene Maßnahmen. Auch die Verringerung der Einfahrtsgeschwindigkeit. Ich denke aber bei einem neuen Tunnel, werden die anderen Lösungen in betracht gezogen. Dies passiert schon in Japan und auch in Deutschland auf den ICE Strecken.
Aerodynamisch optimiertes Tunnelportal am Idsteintunnel
Unter Umständen kann sich auch der gegenüber offenen Strecken deutlich erhöhte Luftwiderstand als Problem erweisen. Der Luftwiderstand in Tunnel ist ein äußerst komplexes, mit Rechenmodellen nur schwer zu erfassendes Phänomen, da verschiedene Prozesse ineinandergreifen. So schiebt einerseits die Stirnfläche des Zuges eine Art „Luftpolster“ in Fahrtrichtung vor sich her (Kolbeneffekt). Andere Luftpakete werden durch den Druckunterschied zwischen Zugspitze (Überdruck) und Zugschluss (Unterdruck) tendenziell dem Zug entlang nach hinten „gesaugt“. Beide Strömungen unterliegen einem mehr oder weniger starken Widerstand, je nachdem ob laminare oder turbulente Strömungsmuster vorherrschen. Der resultierende Luftwiderstand hängt somit von Länge, Querschnittsfläche und Oberflächenbeschaffenheit sowohl des Tunnels als auch des Zuges ab. Während bei Hochgeschwindigkeitszügen der Luftwiderstand sich dank aerodynamischer Formgebung bis zu relativ hohen Geschwindigkeiten in erträglichen Grenzen halten lässt, kann es bei Güter- und vor allem bei RoLa-Zügen infolge verwinkelter Oberflächen sehr leicht zu starken Wirbelbildungen und − vor allem bei langen Tunneln und bereits bei mäßig hohen Geschwindigkeiten − entsprechend hohem Luftwiderstand kommen. Für dessen Überwindung muss nicht nur unverhältnismäßig viel Energie aufgewendet werden; diese muss zudem − in Form von Wärme − wieder aus dem Tunnel abgeführt werden.
Der Tunnelknall (engl. tunnel boom) ist ein physikalisches Phänomen, das beim Hochgeschwindigkeitsverkehr durch Eisenbahntunnel auftritt. Bei Einfahrt von Fahrzeugen mit sehr hoher Geschwindigkeit in einen Tunnel entsteht eine Druckwelle, die dem Zug mit Schallgeschwindigkeit vorauseilt und am Tunnelausgang zu einem explosionsartigen Knall führen kann.
Der Tunnelknall-Effekt wird unter anderem beeinflusst durch:
-
•die Einfahrgeschwindigkeit,
-
•das Zugdesign (vgl. moderne HGV-Züge wie z. B. der japanische Shinkansen),
-
•den Tunnelquerschnitt (enge und glatte Tunnel begünstigen den Tunnelknall-Effekt),
-
•die Länge der Tunnel und
-
•die Oberbau-Ausführung (das System „Feste Fahrbahn“ begünstigt den Effekt)
Um dem Effekt entgegenzuwirken, kommen folgende Lösungen in Betracht:
-
• Querschnittsaufweitungen am Tunnelausgang (Kastenprofile oder trompetenartige Hauben)
-
• Deckenöffnungen am Tunnelportal zum Druckausgleich
-
• Einhausungen am Tunnelportal
-
• Verwendung von Zügen mit aerodynamischer Bugform
-
• Herabsetzung der Einfahrgeschwindigkeit
-
• Erhöhung der Absorptionsfähigkeit des Tunnels durch Strukturierung der Oberflächen (z.B.
durch Schotteroberbau oder eine besondere Innenauskleidung im Tunnel, wie z. B.
Schallabsorber im Gleisbereich der Festen Fahrbahn).

